
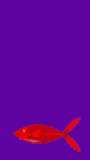
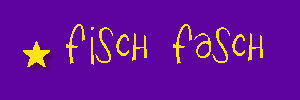
weil ihre Eltern an Aids gestorben sind,
und die sich mit dem HIV-Erreger infizieren, weil sie sich
prostituieren. Wohlhabende alte Männer erhöhen die
Preise für ungeschützten Sex. Nicht zuletzt deswegen
hat Sambia eine der höchsten Aids-Raten und die niedrigste
Lebenserwartung der Welt. Eine Spirale aus Elend, Gewalt und
Prostitution hat zur Folge, dass sich Aids in Sambias Hauptstadt Lusaka
immer weiter ausbreitet
Sie kommen pünktlich. Lucy, 17, mit kunstvoll geflochtenen
langen Haaren, rotem Minirock und weißem Trägerhemd.
Und die kurzhaarige Betty, in engen Jeans und hochhackigen Schuhen, die
Ende 20 ist und viel älter aussieht. Betty ist die
Wortführerin. Die zwei wollen über ihren Alltag
reden, über Prostitution, Aids und Menschenhandel, im
Büro einer Hilfsorganisation am Rande des Compounds.
Compounds - Armenviertel mit der Tendenz zum Slum - gibt es an den
Rändern Lusakas jede Menge, ungefähr jeder
fünfte der rund 10 Millionen Sambier lebt in so einer Gegend.
Reisende kriegen davon meist wenig mit. Das Zentrum von Sambias
Kapitale besteht aus vorwiegen zwei- bis dreistöckigen,
passabel instand gehaltenen Gebäuden und erstaunlich viel
Grün. Die gepflegte Atmosphäre der verglasten
20-Stock-Bürotürme um die Cairo Road wirkt wie eine
Maske. Sie verbirgt eine der höchsten Aids-Raten der Welt.
Nach Angaben von Unaids waren 2001 21,5 Prozent der
Bevölkerung HIV-positiv, nur Botswana, Simbabwe, Swasiland,
Lesotho und Namibia verzeichnen noch höhere Zahlen. DIe
Immunschwäche hat die durchschnittliche Lebenserwartung auf 37
Jahre gedrückt, der niedrigste Wert aller Länder. Die
Schätzungen der durch Aids zu Waisen gewordenen
Minderjährigen schwanken zwischen 570.000 und 1,6 Millionen.
Etliche Unternehmen Lusakas haben mehr als die Hälfte der
Belegschaft verloren und bilden mittlerweile für jede Stelle
drei Kandidaten aus - die Abwesenheit vom Arbeitsplatz wegen der
Teilnahme an Beerdigungen ist für viele Firmen ein immenses
Problem. Dabei ist Sambia ohnehin eine der ärmsten Nationen;
die Wirtschaft erholt sich nur schwer vom Niederganz des einst
florierenden Kupferbergbaus. Dass die meisten Aids-Opfer qualifizierte
Arbeitskräfte im besten Erwerbsalter sind, schmälert
jegliche Hoffnung auf baldige Besserung. Am Ende der Spirale aus Aids,
Armut und Gewalt stehen jene Frauen und Kinder, die sich prostituieren
müssen, um überhaupt zu überleben.
Bevor Betty beginnt, ihre Geschichte zu erzählen, will sie ein
Bier. "Ich war zehn, als mein Vater starb. Seine Familie nahm unseren
ganzen Besitz. So ist es Tradition. Wir, meine Mutter und die Kinder,
erbten nichts. Irgendwie versuchte meine Mutter uns durchzubringen,
aber es reichte hinten und vorne nicht. Für die Schule fehlte
das Geld. Oft hatten wir nicht genug zu essen. Mit 13 hatte ich das
erste Mal Sex, das heißt, ich wurde von drei Typen
vergewaltigt."
Als ihre Mutter krank wurde, begann Betty mit ihrer Schwester den Job
als "sex worker". Von dem Geld bezahlten sie Essen, Miete und die
Schulgebühren für die anderen Geschwister.
Später trafen sie Mitarbeiter angeblicher Hilfsprojekte. "Sie
benutzten unsere Namen und betrogen uns um das Geld. Hier hilft uns
niemand. Die Männer verlangen Dinge, die wir nicht tun wollen.
Sie schlagen und foltern uns. Wir haben Sex wie Tiere."
Betty umkrallt mit einer Hand die Bierflasche, die andere fuchtelt
durch die Luft: "Auf der Straße neulich fand ich eine
Achtjährige, die mit zwei Männern zugleich Sex hatte.
Sie hatte Syphilis, ich brachte sie ins Krankenhaus. Sechs
Mädchen habe ich schon dorthin gebracht. Ich sage ihnen, dass
sie sterben werden, wenn sie so weiter machen. Wenn du aber einen
findest, der dir 50 oder 100 Dollar anbietet, machst du alles, was er
will. Dabei wissen die Mädchen genau, dass Aids
tötet." Betty will noch ein Bier.
"Einmal hat mich ein Typ einfach verkauft und ich landete in
Südafrika. In einer Stripshow sollte ich tanzen. Viele
Mädchen hier wurden verkauft, auch nach Deutschland. Als wir
ankamen, nahmen sie unsere Pässe weg, dafür brachten
sie Kunden. Manchmal kamen sie zu zweit. Vom Geld sahen wir nichts.
Irgendwann fanden wir einen Nigerianer, der Pässe
fälschte, und kamen zurück nach Lusaka."
Tagsüber präsentiert sich das Viertel Northmead, gut
zwei Kilometer von der Hauptgeschäftsmeile Cairo Road
entfernt, als Einkaufszentrum mit wenigen Läden und vielen
klapprigen Marktbuden. Das Angebot reicht vom zerbeulten Kochtopf
über die japanische Stereoanlage bis zum säckeweise
verkauften Grundnahrungsmittel Maismehl. So gut wie jede kleine und
kleinste Brachfläche in der Umgebung ist ein improvisiertes
Maisfeld.
Mit Einbruch der Dunkelheit wird aus der Einkaufsgegend ein
Vergnügungsgebiet. Zusammengeflickte asiatische Kleinwagen,
die behaupten, Taxis zu sein, suchen sich ihren Weg zwischen
unzähligen Schlaglöchern. Vor den Eingängen
der Bars und Diskotheken drängeln sich die Gäste.
Unter den Bäumen am Straßenrand warten junge Frauen
auf Kundschaft. Autos fahren im Schritttempo, halten an, Türen
öffnen und schließen sich.
Straßenprostitution gibt es an vielen Ecken der Stadt,
überall auch Trinkschuppen und Tanzkneipen, in denen Sex
käuflich ist. Das Geschäft ist kaum organisiert und
die Kundschaft reicht von armen Familienvätern bis zu
"Sugardaddys", wohlhabenden alten Männern, die sich eine
Schülerin oder junge Studentin als feste Mätresse
halten. Sie zahlen mit Statussymbolen wie den neuesten Turnschuhen oder
der Übernahme der Studiengebühren und glauben, dass
die Jugend ihrer Geliebten sie vor dem Aids-Risiko schützt.
Umgekehrt gilt das sicher nicht. Landesweit ist jeder fünfte
Sambier HIV-positiv, in Lusaka jeder dritte, und die meisten
Neuinfizierten sind Frauen. Es heißt, dass weit mehr als die
Hälfte aller Mädchen hier Beziehungen zu einem
"Sugardaddy" haben.
"Vor 20 Jahren gab es in Sambia keine Prostitution", behauptet Waza
Kaunda, Sohn des legendären früheren
Präsidenten Kenneth Kaunda und Direktor der "Children of
Africa Foundation". Dann sei Aids gekommen und mit ihm der
Teufelskreis. Drei Viertel der Mädchen, die sich in Lusaka
prostituieren, hätten ihre Eltern durch Aids oder Malaria
verloren. Früher, da habe nicht einmal das Wort "Waise" in den
Bantu-Sprachen der Einheimischen existiert. Die Familien seien
groß und stark gewesen, die Kinder wurden einfach
aufgenommen. Das sei nun immer weniger möglich, weil die
Verstädterung steige und mit ihr das Elend. "Was sollen diese
Mädchen denn machen?", fragt Kaunda. Weise er sie auf die
Aids-Gefahr hin, antworteten sie ihm: "Doktor, an Hunger kann ich
nächste Woche sterben, an Aids erst in zehn Jahren."
Dabei sei die Prostitution nur ein Faktor. Mindestens ebenso schlimm
sei die Promiskuität, ausgelebt etwa am Arbeitsplatz. Und das
schlimmste steht noch bevor - laut Unaids wird die Epidemie ihren
Höhepunkt frühestens 2010 erreichen. Schon heute habe
fast jeder hier Verwandte durch Aids verloren. Dann holt Kaunda weit
aus. Er spricht von den überhasteten
Strukturanpassungsprogrammen, die Sambia von der Weltbank und dem
Internationalen Währungsfond 1991 aufgezwungen wurden, von der
Aufhebung der Subventionen, dem Ende der Preis- und Importkontrollen,
der Privatisierung staatlicher Unternehmen und davon, dass heute 80
Prozent der Sambier weniger als einen Dollar pro Tag haben.
Er fragt, warum Mercedes und BMW nicht in Lusaka investieren -
schließlich sei Afrika doch ein großer Markt
für deutsche Autos. Nur dass sie keiner kaufen kann, wenn alle
sterben, das sieht er schon auch so. "Aids ist vielmehr als ein
Entwicklungs- und Gesundheitsproblem". sagt er endlich.
In der "Alphabar" in Northmead zitieren Lichtorgel und Spiegelkugel die
70er Jahre. Entsprechend die Kleidung: Bunt, glitzernd und bei Frauen
vor allem eng. vieles scheint von den Märkten zu stammen, auf
denen Second-Hand-Klamotten aus Europa und den USA verkauft werden. Es
ist voll. Die Frauen sind jung, meist noch Teenager, die
Männer nicht viel älter. Lucy, 17, arbeitet hier und
in der Umgebung.
Ihre Mutter starb, als sie 15 war, der Vater war schon lange weg. Lucy
zog zu ihrer Tante, die nur bereit war, für ihre eigenen
Kinder das Schulgeld zu bezahlen. Lucy kam bei einer Prostituierten
unter. Irgendwann war es nicht mehr möglich, nein zu sagen.
Mittlerweile wartet Lucy nachts an der Straße auf Typen.
Für Sex verlangt sie umgerechnet 10 Euro, die meisten wollen
nur ein Drittel zahlen. "Wenn du ihr Angebot anblehnst,
schmeißen sie dich in einer üblen Gegend hinaus."
Lucy redet laut, schnell und ohne Scham. Es ist ihr Alltag, ihr Leben.
Sie drängt sich an die belagerte Theke, um Bier zu holen.
Schwer zu sagen, wer auf der Tanzfläche die Lust am eigenen
Körper ausstellt und wer sich prostituiert. Fast jeder
Blickkontakt transportiert ein Angebot. Freundliche Ablehnungen werden
freundlich akzeptiert. Die "Alphabar" ist kein Bordell, eher eine
Mischung aus Disco und Kontakthof.
An einer Straßenecke steht Lucys Kollegin, eine zierliche
Frau um die 20. Ihr fehlt ein Auge. Ein verrückter Kunde, der
auf Drogen war, habe es ihr rausgeschnitten. Sie hat überlebt.
Kaum waren die Fäden gezogen, stand sie wieder hier.
Weiter geht's, ins Xenon, einen sterilen Club im 80er-Jahre-Stil. Im
Vergleich zur Alphabar wirkt das Publikum wohlhabender, die
Männer sind älter. Die Frauen nicht. Enige der
Mädchen auf der Tanzfläche wirken keinesfalls
älter als zwölf. Sue tragen hohe Stiefel, kurze
Röcke, dicke Schminke und behaupten, sie seien
volljährig. Jeder Gast hat mehrere Begleiterinnen, einige
Mädchen lassen die Hüften kreisen.
Lucy kennt die meisten. Sie erzählt von den beiden Dicken an
der Bar, die jetzt viel Geld haben, weil sie Pornos mit Hunden drehen.
Sie erzählt von dem Mann, der sie schwängerte. Wie
sie ihm Zwillinge gebar, für die er erst zu zahlen versprach
und dann abhaute, als sie im sechsten Monat war, zurück nach
Norwegen - ohne Adresse. Jetzt bezahle sie jemanden, der auf die Kinder
aufpasst. Beim Abschied auf der Straße weist Lucy auf eine
Polizeistation gegenüber. Prostitution ist verboten in Sambia.
Die Polizei verfolge sie in Zivilautos. "Webb sie dich erwischen,
verlangen sie 10.000 Kwacha (etwa 2 Euro). Wenn du die nicht hast,
wollen sie Sex. Wenn du nicht mitmachst, sperren sie dich ein und am
nächsten Tag musst du die Station putzen. Vor zwei Tagen haben
sie alle meine Freundinnen gefickt. Sie nehmen nicht einmal Kondome."
Wie viele Prostituierte es tatsächlich in der Hauptstadt gibt,
kann auch Stanley Charma nicht sagen. "Zehntausende bestimmt -
vielleicht auch mehr als 100.000." Charma ist Leiter der
Hilfsorganisation Kara Councelling, dei mit
Aufklärungskampagnen und Trainigsprogrammen Aids in Lusaka
bekämpft, mit Geld aus der ganzen Welt, das zudem zahlreichen
Mitarbeitern die Existenz sichert. Auf den meisten der großen
Geländewagen in den Straßen Lusakas klebt das Logo
einer Hilfsorganisation.
In Lusaka würden die Menschen langsam beginnen, die Existenz
von Aids zu akzeptieren, sagt Charma. Als offizielle todesursache
würde nicht mehr so oft Malaria oder Tuberkulose angegeben,
und immer weniger Menschen vermuteten hinter vorgehaltener Hand
"Hexerei". Nach mehr als zwei Jahrzehnten Aids in Sambia sei das
zumindest ein Anfang.